Grundsätzlich schon. Aber um ein häufiges Missverständnis zu klären: Oft wird gesagt, die OECD habe beschlossen, in keinem beteiligten Staat dürfe die Unternehmenssteuer gesetzlich unter 15 Prozent liegen. Das ist nicht richtig. Es geht um eine sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung: Länder, aus denen Unternehmensgewinne in Länder mit tieferen Steuersätzen abfließen, haben das Recht, die Differenz dieses tieferen effektiven Steuersatzes zu den jetzt beschlossenen 15 Prozent auf ihre eigene Unternehmensbesteuerung draufzuschlagen. Beispiel: Wenn ein in Sambia tätiges Unternehmen einen Teil seiner Gewinne in einer Steueroase mit einem Steuersatz von zehn Prozent abführt, dann darf Sambia zumindest in der Theorie die abfließenden Gewinne mit fünf Prozent zusätzlich besteuern. Das ist sinnvoller, als wenn die OECD einen verbindlichen Mindeststeuersatz festgelegt hätte. Denn dann hätte etwa ein Land wie die Schweiz einfach neue Möglichkeiten des Steuerabzugs für Unternehmen einführen und auf diese Weise die 15 Prozent wieder unterbieten können. Die Reform setzt letztlich einen ökonomischen Anreiz für Unternehmen: Die müssen sich jetzt ausrechnen, ob es sich noch lohnt, Gewinne in Niedrigsteuergebiete zu verschieben.
Bringt das den armen Ländern im globalen Süden etwas?
Im Prinzip ist der Ansatz der Reform sinnvoll und wirksam, die Gewinnverschiebung auch aus Entwicklungsländern zu unterbinden. Das Problem ist aber, dass die 15 Prozent sehr niedrig sind. Die Schweiz etwa hat heute einen Durchschnittssteuersatz von knapp unter 15 Prozent – die Reform geht also von einem ohnehin schon sehr tiefen Niveau aus. In den meisten Staaten in Afrika hingegen, in denen Rohstoffe abgebaut werden, liegen die Unternehmenssteuern bei 25 bis 35 Prozent. Für einen Rohstoffhändler wie Glencore, der in Sambia Kupfer abbaut, wird es sich weiterhin lohnen, Gewinne von dort an seinen Firmensitz in Chur zu verschieben, weil der Aufschlag, den er in Sambia zahlen muss, sehr klein ist. Der von der OECD beschlossene Mindeststeuersatz hätte also deutlich höher liegen müssen; Fachleute sagen mindestens 20 bis 25 Prozent. Hinzu kommt, dass die Hinzurechnungsbesteuerung so ausgestaltet ist, dass sie für die Sitzländer der Konzerne sehr viel einfacher anzuwenden ist als etwa für die Rohstoffexporteure in Afrika. Deshalb wird sie einem Land wie Sambia in der Praxis nicht viel bringen.
Die Verschiebung von Gewinnen lohnt sich künftig aber nur dann, wenn der Steuersatz im Zielland nicht zu niedrig ist, sondern nahe bei 15 Prozent liegt, oder? Denn je größer die Differenz zu den 15 Prozent, desto mehr darf ein Land bei sich zuhause draufschlagen.
Im Prinzip ja. Letztlich geht es aber darum, dass die Konzerne mindestens 15 Prozent zahlen, egal wo sie wieviel versteuern. Wenn die Reform umgesetzt wird, dann könnte immerhin ein Steuerwettlauf nach unten zwischen Niedrigsteuergebieten wie den Niederlanden, Irland, der Schweiz und einigen US-Bundesstaaten gestoppt werden. Andererseits haben Staaten mit höheren Steuersätzen jetzt einen Anreiz, ihre Unternehmenssteuern auf 15 Prozent zu senken. Der durchschnittliche Steuersatz, der global derzeit bei etwa 25 Prozent liegt, könnte als Folge der Reform also sinken. Man spricht deshalb auch schon davon, dass der Wettlauf nach unten durch einen Wettlauf zum Minimum ersetzt wird. Das Szenario ist plausibel, dass die Reform zu einer Nivellierung bei 15 Prozent führt.
Die Mindeststeuer ist eine von zwei Säulen der Reform. In der anderen Säule geht es um die Versteuerung von sogenannten Übergewinnen in den Ländern, in denen Konzerne Geschäfte machen, aber nicht ihren Sitz haben. Was heißt das?
Nehmen wir den Pharmakonzern Novartis als Beispiel: Der würde nach der Reform einen kleineren Teil seiner Gewinne als heute am Firmensitz Basel versteuern, dafür mehr in den Ländern, in denen seine Medikamente verkauft werden. Der Begriff „Übergewinn“ ist dabei ziemlich schwammig. Die OECD hat eine technische Definition formuliert, inwiefern die umsetzbar ist, werden wir sehen. Fest steht: Der Anteil, der von der OECD definierten Übergewinne an den Gesamtgewinnen eines Unternehmens ist relativ klein. Von dieser Säule der Reform betroffen sind zudem nur die allergrößten transnational tätigen Konzerne mit einem Jahresumsatz von 20 Milliarden Euro und einer Profitrate von zehn Prozent; in der Schweiz sind das gerade mal Novartis, Roche und vielleicht noch Nestlé.
Was bringt dieser Teil der Reform den ärmeren Ländern?
Er bewirkt eine Umverteilung von den Sitzstaaten der Konzerne zu den Marktstaaten, aber nicht in die Produktionsländer und zu den Rohstoffexporteuren. Textilproduzenten wie etwa Bangladesch oder Kambodscha haben wenig von der Reform, weil sie lediglich Produktionsstandorte, nicht aber Absatzmärkte der Textilkonzerne sind. China hingegen wird sehr wahrscheinlich profitieren, weil es mittlerweile eine im internationalen Vergleich sehr große Schicht von Verbrauchern hat, die auf westlichem Niveau konsumieren.
Auch dieser Teil der Reform wird den Entwicklungsländern insgesamt also wenig bringen, oder?
Genau, am ehesten profitieren könnten noch bevölkerungsreiche Länder mit mittlerem Einkommen wie Indonesien.
Was hätte anders gemacht werden müssen?
Grundsätzlich zu begrüßen ist die Idee, einen Schlüssel zur Verteilung von Konzerngewinnen und damit auch der Besteuerungsrechte zu etablieren. Würde man in einem solchen Schlüssel den Faktor Arbeit berücksichtigen, dann würde ein Teil der Gewinne in die armen Produktionsländer fließen und dort besteuert werden können. Unsere zentrale Forderung ist deshalb, in einem Verteilschlüssel neben Umsatz und Gewinn auch den Faktor Arbeit stark zu berücksichtigen, die reale Wertschöpfung. Das würde dann auch den rohstoffexportierenden Ländern zugutekommen.
Waren Entwicklungsländer in irgendeiner Weise an der jetzt beschlossenen Reform beteiligt?
An den Verhandlungen haben 139 Staaten im Rahmen des „Inclusive Framework“ der OECD teilgenommen; aus Afrika waren etwa Nigeria, Südafrika und Kenia dabei. Aber in der Steuerungsgruppe der Reform waren die westlichen OECD-Mitglieder in der Mehrheit; Deutschland hatte lange das Präsidium inne. Mit anderen Worten: Entschieden haben am Ende wieder die üblichen Verdächtigen. Hinzu kommt, dass Niedrigsteuerländer und Sitzstaaten von Konzernen wie die Schweiz, Irland, die Niederlande und Luxemburg Koalitionen eingehen, weil sie dieselben Interessen haben. Luxemburg, die Niederlande und Irland wiederum vertreten diese Interessen in der Europäischen Union, die ihrerseits versucht, eine gemeinsame Position zu formulieren. Die G7 tut das auch – und am Ende steht ein Kompromiss, mit dem die USA, Frankreich, Deutschland und eventuell auch die Schweiz und die Niederlande gut leben können. Alle anderen sind dann außen vor. Bislang haben auch nur 130 der 139 beteiligten Staaten die Einigung unterschrieben: Außer den Steueroasen Irland und Barbados fehlen bisher auch Nigeria, Kenia und Peru.
Aus diesem Grund hat ein Expertengremium – das sogenannte FACTI-Panel – vor einigen Monaten gefordert, über Reformen der internationalen Steuerpolitik sollte in den Vereinten Nationen entschieden werden. Stimmen Sie zu?
Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Voraussetzung ist aber, dass die Staaten bereit sind, die Vereinten Nationen mit entsprechenden Kompetenzen und Mitteln auszustatten. Daran scheitert ein wirksames Engagement der UN ja häufig auch in anderen Politikbereichen.
Vertreter der deutschen Bundesregierung haben sich auf einer Diskussionsveranstaltung zu den Ergebnissen des FACTI-Panels im Frühjahr deshalb dagegen ausgesprochen, die UN damit zu beauftragen.
Das finde ich eine zynische Argumentation. Zum einen ist die OECD in dieser Hinsicht auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Auch dort wurde über die jetzt beschlossene Reform immerhin sechs Jahre verhandelt. Eigentlich war das Ziel, die internationale Besteuerung einfacher zu machen, jetzt aber wurde auf das bestehende System noch etwas Neues draufgesetzt, was alles noch komplizierter macht. Zum anderen hat bei der OECD das globale Kapital die Übermacht, um das mal vulgärmarxistisch auszudrücken, während in den Vereinten Nationen die gesamte Weltwirtschaft am Tisch sitzt: Reiche und arme Länder begegnen sich dort grundsätzlich auf Augenhöhe. Natürlich sind die Interessengegensätze da größer und es ist komplizierter, eine Einigung zu erzielen. Aber wenn eine Einigung erzielt wird, dann ist immerhin einigermaßen garantiert, dass alle dahinterstehen und nicht bloß wieder die großen Märkte und Sitzstaaten der Konzerne.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
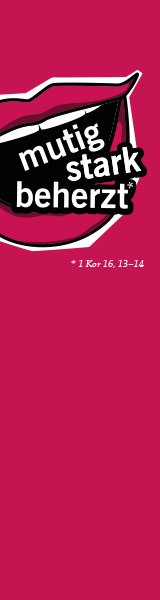
Neuen Kommentar hinzufügen